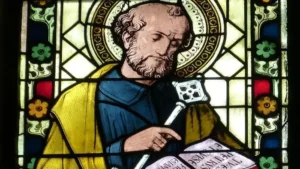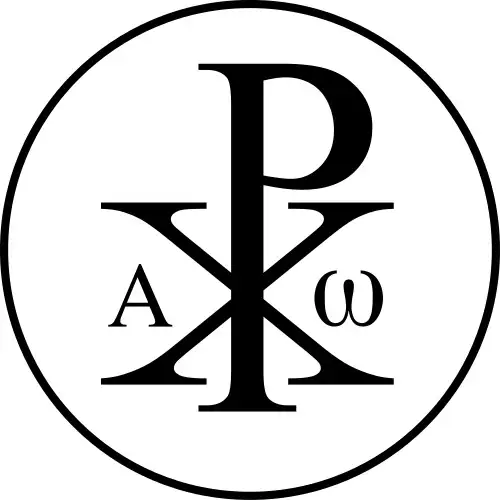F. X. Weninger SJ: Katholizismus, Protestantismus und Unglaube

Zweites Hauptstück
Erster Abschnitt – 1. Merkmal der Kirche Die Einheit
Die wahre Kirche Christi muss mit dem Merkmal der Einheit bezeichnet sein, erstlich in ihrer Gründung, da ihr Stifter kein anderer ist als eben Christus. Sie muss aber auch in Hinsicht auf den Glauben, die Mittel des Heiles und in ihrer Verfassung und Obergewalt dieses Merkmal der Einheit an sich tragen und zugleich als die eine allein wahre Kirche, für alle Menschen erkennbar und somit sichtbar sein. – Die heilige Schrift weist auch ausdrücklich und ganz vorzüglich auf dieses Merkmal hin.
In Hinsicht auf den Stifter gibt dafür das Evangelium und alle die übrigen Bücher des Neuen Testaments Zeugnis. In Hinsicht auf den Glauben und die Mittel des Heiles verlangt Christus diese Einheit gleichfalls, indem er selbst seine Apostel aussendet, alle Völker das halten zu lehren, was er sie gelehrt und ihnen zu halten befohlen, und er setzt feierlich bei: „Wer nicht glaubt, der wird verdammt“. (Mark. XVI. 16 u. Matth. XXVIII. 19, 20) Nur denen, welche in diesem Glauben, in dieser Hoffnung und Liebe leben und sterben, verheißt er das ewige Leben. Und ausdrücklich betet Er zum Vater, „dass alle eins seien, so wie der Vater in Ihm und Er im Vater sei.“ (Joh. 17,24)
Was die Einheit der Kirche in Hinsicht auf ihre Verfassung und Verwaltung zufolge der Anordnung Christi betrifft, so erhellt dieselbe aus der hochfeierlichen Beglaubigung, mit welcher Er seine Apostel zu Hirten und Leitern seiner Kirche bestellte: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh. 20, 21) „Wer euch verachtet, der verachtet mich.“ Und wieder: „Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und ein Publikan.“ (Matth. 48, 17)
Besonders aber gab Christus seinen Willen in dieser Beziehung dadurch kund, dass Er der Kirche in der Person des hl. Petrus und seiner Nachfolger ein sichtbares Oberhaupt gab, indem Er zu demselben in Gegenwart aller übrigen Apostel sprach: „Dir gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches.“ Und später zu dreien wiederholten Malen Ihm den Auftrag gab: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe.“ (Matth. 16, 19; Joh. 20, 16. 17)
Auf diese Einheit als Bedingung des Heiles und der Wahrheit weisen auch mit feierlichstem Nachdruck die Apostel: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“, schreibt der hl. Paulus in seinem Sendschreiben an die Epheser, und dringt auf die Einheit in seinen Briefen an die Philipper, Galater, Römer und Korinther. (Phil. 2, 2; Gal. 1, 6-9; Röm. 19, 17; 1. Kor. 1, 10)
Ebenso zeigt er die Einheit der Kirche aus der Teilnahme an denselben heiligen Sakramenten, insbesondere an dem allerheiligsten Sakrament des Altars: „Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Herrn? So sind wir, wenngleich viele, nur ein Brot, ein Leib, wir alle, die wir von dem einen Brot genießen.“ (1. Kor. 10, 16 u. 17)
Was die Einheit der Leitung in der Kirche betrifft, so dringt der hl. Paulus auf dieselbe besonders in seinen Briefen an Timotheus und Titus. Überdies bezeugt die Apostelgeschichte (Kap. 15) durch das, was sie von dem ersten Konzil zu Jerusalem erzählt, die Obergewalt des hl. Petrus als sichtbaren Oberhauptes der Kirche. Wo immer Christus von der Kirche spricht, spricht Er als von der einen, die er zu stiften kam. Er, die ewige Wahrheit, konnte doch auch wahrlich nicht verschiedene sich widersprechende Kirchen stiften.
Auch alle Sinnbilder, unter welchen Christus und seine Apostel von der Kirche reden, drücken dies Einheit aus. Sie bezeichnen nämlich die Kirche als ein Haus, eine Erbschaft, ein Königreich, eine Stadt, eine Herde, ein Kriegsheer, als den einen Leib Christi.
Die ganze Geschichte der Kirche beweist, dass sie allezeit von dem lebhaftesten Bewusstsein ihrer von Christus gegründeten vollkommenen inneren und äußeren Einheit durchdrungen war. Daher forderte sie von allen ihren Mitgliedern Einheit des Glaubens und Unterwerfung unter die eine von Christus eingesetzte Kirchengewalt und schloss alle, die sich von dieser Einheit lossagten, als Irrgläubige und Schismatiker von ihrer Gemeinschaft aus.
Es versteht sich von selbst, dass diese Einheit sichtbar ist und sein muss, wie die Kirche selbst.
Die Kirche wurde ja für Menschen gestiftet, die keine puren Geister sind; alle ihre Gnaden- und Heilsmittel sind an sichtbare Zeichen geknüpft, und auch diejenigen, welche sie zu spenden haben, sind sichtbare Menschen. – Eine unsichtbare Kirche wäre überhaupt für uns Menschen eine nutzlose, weil unerkennbare.
Dieses Merkmal der Einheit besitzt aber ebenso unwidersprechlich und offenbar nur die katholische Kirche und keine andere religiöse Gemeinschaft.
Die katholische Kirche, wie sie heute da steht und durch achtzehnhundert Jahre da stand, ist in der Tat einig.
Einig ist die katholische Kirche in ihrem Stifter, einig in ihrer Lehre, einig in ihrer inneren und äußeren Verbindung, durch den Gebrauch derselben Mittel des Heiles und besonders einig durch ihren Anschluss an das eine Oberhaupt, den Nachfolger Petri, den römischen Papst. Dieses Merkmal der Einheit strahlt an ihr unbestreitbar.
Kein Mensch auf Erden kann einen anderen Stifter derselben angeben, als den einen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Kein Mensch auf Erden kann einen einzigen Glaubenssatz nennen, den nicht alle Kinder der katholischen Kirche gleichmäßig bekennen. Kein Mensch auf Erden kann es leugnen, dass sie dieselben Sakramente auf dem ganzen Erdball den Ihrigen spendet und dasselbe heilige Opfer auf ihren Altären dem Herrn darbringt, und dass sie nirgendwo ein anderes geistliches Oberhaupt anerkennt, als den einen Nachfolger Petri, den römischen Papst.
Betrachtet dagegen, Freunde! Die Zerrissenheit und Uneinigkeit der zahlreichen protestantischen Sekten, die schon zu Luthers Zeiten so groß war, dass er sich darüber in den bittersten Worten beklagte und genötigt ward, eben diese Zerfahrenheit der Lehrmeinungen als ein Merkmal des Irrtums anzuerkennen.
Jedermann kennt das berühmte Werk des großen Bossuet: »Histoire des variations des églises protestantes«, in welchem er authentisch die unzähligen Veränderungen und Meinungsverschiedenheiten des niemals mit sich selbst einigen Protestantismus nachweist.
Ein deutscher Gelehrter verfasste sogar eine ganze katholische Dogmatik, zusammengetragen aus lauter protestantischen Autoren, von denen der eine diesen, der andere jenen katholischen Lehrsatz gelten ließ, wenngleich keiner jeden dieser Lehrsätze logisch verfolgte, gleich wie man einen zerschlagenen Spiegel aus seinen Stücken wieder zusammensetzt und doch nicht eint. Dieses Werk weist dadurch offenbar nach, woher der Protestantismus ausgegangen, und wie jammervoll er zugleich das Erbgut des heiligen Glaubens verschleudert hat.
Hört, was selbst Rousseau von den protestantischen Predigern seiner Zeit behauptet. Er zeichnet damit die Mehrzahl derselben zu allen Zeiten und an allen Orten, namentlich hier in Amerika. „Sie wissen nicht mehr“, sagt er, „was sie glauben, noch was sie wollen, noch was sie behaupten. Zufälligkeiten entscheiden über ihren Glauben. Ihre ganze Begründung besteht in einem Angriff auf den Glauben anderer.“ Gerade so auch hier und überall, auch heutzutage.
Als ein deutscher Fürst in unserer Zeit in Paris katholisch wurde, da versammelte er nach seiner Rückkehr eine Anzahl von Pastoren, um ihnen Rechenschaft von seinem Schritt zu geben. Er erklärte, dass es besonders die konsequente Einheit der katholischen Lehre sei, die ihn bewog, zu prüfen, und die ihn endlich zur Erkenntnis der Wahrheit der katholischen Kirche selbst gebracht habe. Er habe bei den Protestanten diesen Charakter der Einheit durchaus nicht gefunden.
Hierauf erwiderten die versammelten Pastoren, diese Anschuldigung sei unbegründet, in den wesentlichen Lehrsätzen seien auch die Protestanten einig. Da fragte sie der Herzog: Halten sie die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen für eine wesentliche Lehre des Christentums? Allerdings. Nun denn, sagte der Herzog, sich zu einem der anwesenden Pastoren wendend, belieben Sie und sagen Sie mir, wie definieren Sie den Begriff der Rechtfertigung?
Der gab seine Definition. Er hatte noch nicht ausgesprochen, da fiel ihm schon ein anderer ins Wort: Vergebe, Herzog, das ist meine Ansicht nicht, ich verstehe unter Rechtfertigung etwas anderes. Nun gab er seine Definition. Sie war kaum ausgesprochen, da erhob sich auch wieder ein dritter mit noch einer anderen Definition.
Da lächelte der Herzog und sagte: Meine Herren, da haben Sie nun selbst den Beweis von der Einheit protestantischer Prediger und ihrer Lehre. Ihr könnt dagegen nicht sagen, es gebe auch katholische Gelehrte, die einander widersprechen und entgegengesetzter Meinung seien, denn dieses ist nie der Fall in Glaubenswahrheiten, die von der Kirche entschieden sind. So wie ein Gelehrter das täte, hörte er auf, katholisch zu sein. Hingegen bei euch bleibt er Protestant, wie früher, und hat sogar das Recht, seine Meinung zu behaupten, wenn auch alle Protestanten der Welt anders dächten, da ja der Protestantismus jedem das Recht zugesteht, in Dingen des Glaubens sein eigener Richter zu sein. –
aus: Franz Xaver Weninger, Katholizismus, Protestantismus und Unglaube. Ein Aufruf an alle zur Rückkehr zu Christentum und Kirche, 1869. S. 79 – S. 83
Folgebeitrag: 2. Merkmal der Kirche Die Heiligkeit
***
Weitere Beiträge von F. X. Weninger auf dieser Website siehe:
- Beiträge von F. X. Weninger
- F. X. Weniger, Katholizismus, Protestantismus und Unglaube – Inhaltsangabe des Buches
Siehe auch weitere Beiträge von F. X. Weninger auf katholischglauben.info: