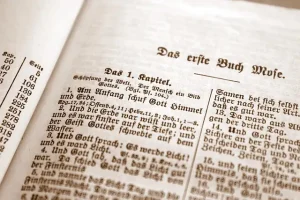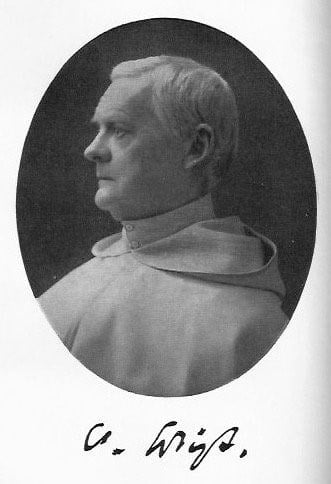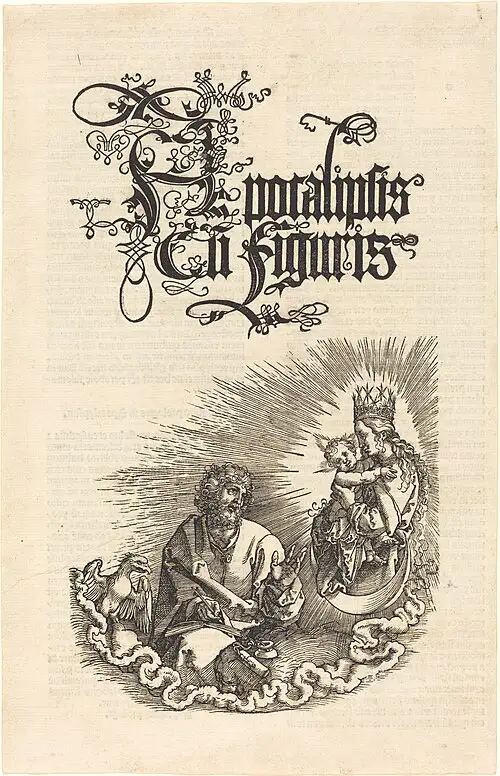Das Buch der Weisheit
Kap. 13. Die Torheit der Abgötterei
1. Alle Menschen sind eitel (1), die keine Erkenntnis Gottes haben, die aus den sichtbaren Gütern den nicht begreifen, der da ist (2) und den Meister aus seinen Werken nicht erkennen: Röm. 1, 28.
2. Sondern entweder das Feuer oder den Wind oder die schnelle Luft oder den Kreis der Sterne oder das große Gewässer oder Sonne und Mond für Weltbeherrscher und Götter halten. 5. Mos. 4, 19; 17, 3.
3. Haben sie diese Dinge für Götter gehalten, weil sie von ihrer Schönheit eingenommen wurden, so hätten sie doch einsehen sollen, wie viel schöner ihr Herr ist: denn der Schöpfer der Schönheit hat all dies gemacht.
4. Haben sie aber über die Kraft und Wirkung dieser Dinge sich verwundert, so hätten sie erkennen sollen, dass der, so sie erschaffen, noch stärker sei.
5. Denn aus der Größe der Schönheit an den Geschöpfen kann man schlussweise (3) ihren Schöpfer erkennen.
6. Gleichwohl ist über diese noch weniger zu klagen (4): denn da sie Gott suchen und ihn nicht finden wollen, irren sie vielleicht nur. (5).
7. Denn indem sie sich mit seinen Werken beschäftigen und forschen, werden sie von dem eingenommen (6), was sie sehen, weil es gut ist. (7) Röm. 1, 21.
8. Doch sind auch sie nicht zu entschuldigen:
9. denn wenn sie zu solcher Einsicht kommen konnten, um über die Welt zu forschen, wie haben sie nicht noch leichter der Welt Herrn gefunden? (8)
10. Aber unglücklich sind, und ihre Hoffnung ist Tod (9), welche Werke von Menschenhänden Götter heißen, Gold und Silber, Kunstgebilde, Tiergestalten oder unnütze Steine, eines alten Künstlers Werk.
11. So fällt ein Zimmermann ein taugliches Holz im Walde, schabt davon geschickt die ganze Rinde ab und zimmert mit emsiger Kunst ein nützliches Gerät zur Notdurft im Leben.
12. Die Abschnitze seiner Arbeit gebraucht er, um Speise zu kochen:
13. aber was sonst davon noch übrig bleibt und unnütz ist, das krumme knotige Holz schnitzt er fleißig in müßigen Stunden, formt es sinnig nach seiner Kunst und macht es zum Bild eines Menschen,
14. oder Tieres, bestreicht es mit Rötel (Roter Ocker), gibt ihm eine rote Farbe, überstreicht alle Flecken an demselben rot anmalt und alle Stellen bedeckt, die darin sind: 15 und macht ihm eine bequeme Wohnung und setzt es in eine Wand und befestigt es mit Eisen.
15. macht ihm ein passendes Häuslein, setzt es in die Wand und befestigt es mit Eisen,
16. damit es nicht etwa falle; denn er sorgt dafür, weil er weiß, dass es sich selber nicht helfen kann, weil es ein Bild ist und Hilfe vonnöten hat:
17. dann gelobt er für seine Habe, für Weib und Kinder Gelübde und sucht Rat dabei und schämt sich nicht, mit etwas Leblosem zu reden.
18. Einen Schwachen fleht er um Gesundheit, einen Toten bittet er um das Leben, einen Hilflosen ruft er um Hilfe an:
19. eine glückliche Reise erbittet er von dem, der nicht gehen kann; Gewinn, Gewerbe und Gelingen in allen Dingen erfleht er von dem, der zu allem unnütz ist. (10)
Anmerkungen:
(1) töricht. Im griech.: sind eitel von Natur, d. i. recht eigentlich eitel.
(2) den Wesentlichen, im Gegensatz zu den Erscheinungen. S. 2. Mos. 3, 14.
(3) Im Griech.: analogisch. Ein schön eingerichtetes Werk muss einen vernünftigen Urheber haben.
(4) Der heilige Verfasser unterscheidet zwei Arten Abgötterei; die einen, welche Gott in der Natur suchen, und Naturdinge für Gott anbeten; die anderen, welche sich ihre Götzen schnitzen. Die ersteren, sagt er, seien schon zu tadeln, indem sie leicht von der Schönheit der Geschöpfe zu dem Schöpfer aufsteigen könnten, aber noch mehr die letzteren, von denen er von Vers 10 an handelt.
(5) wie nach? Zeigt Vers 7.
(6) überredet.
(7) Die Güte und Vortrefflichkeit mancher Geschöpfe überredet sie, Gott in ihnen gefunden zu haben.
(8) Der Welt Urheber finden ist leichter, als Forschungen über die Geschöpfe anstellen; denn dass die Welt einen Urheber haben müsse, ist so leicht und fasslich, dass selbst Kinder darauf verfallen können.
(9) wird nie erfüllt, weil sie auf toten, leblosen Geschöpfen ruht.
(10) Vergl. Isai. 44, 9-16; Jer. 10, 3-5; Baruch 6, 3-39.
Von dem Bilderdienst, der hier verworfen wird, muss man wohl die Verehrung unterscheiden, welche den Bildern der Heiligen oder Gottes selber zu erweisen erlaubt ist. Beim heidnischen Bilderdienst schreibt man den Bildern selbst eine göttliche oder geistige Kraft zu, und bezieht darum die Ehre, die man ihnen erweist, auf sie selbst:
bei der Verehrung der Bilder, wie sie den Christen erlaubt wird, ist es keineswegs Glaube, dass die heiligen Bilder in sich eine göttliche oder geistige Kraft enthalten, um diese oder jene Gnaden zu erweisen, sondern die Christen bedienen sich derselben nur als Erinnerungszeichen an die Personen und Geheimnisse, die sie vorstellen, und beziehen alle Verehrung, die sie ihnen leisten, nicht auf sie, sondern eben auf jene Personen und Geheimnisse. –
aus: Joseph Franz Allioli, Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentes. Aus der Vulgata, 3. Bd. 1838, S. 432 – S. 433
Kap. 14 Fortsetzung. Ursprung des Götzendienstes
1. Wieder ein anderer denkt sich einzuschiffen, und tritt die Reise auf den wilden Fluten an: er ruft ein Holz an, das gebrechlicher ist als das Holz, das ihn trägt. (1)
2. Dieses Holz (2) hat die Gewinnsucht erfunden, und der Künstler in seiner Weisheit gebaut:
3. aber deine Vorsicht, o Vater! Regiert es, weil du auch im Meer einen Weg gabest, und eine gar sichere Bahn zwischen den Wellen, 2. Mos. 14, 22.
4. Um zu zeigen, dass du Macht habest, aus allen Gefahren zu retten, auch wenn einer ohne Kunst aufs Meer käme. (3)
5. Und damit die Werke deiner Weisheit (4) nicht umsonst seien, so vertrauen die Menschen einem geringen Holz ihr Leben an und kommen glücklich in dem Schiff über das Meer.
6. Auch vor Alters, da die hochmütigen Riesen umkamen (5), floh die Hoffnung des Erdkreises (6) in ein Schiff, welches deine Hand regierte, also dass der Welt ein Same der Nachkommenschaft blieb. 1. Mos. 6, 4; 7, 7.
7. Darum ist gesegnet das Holz, wodurch Gerechtigkeit erfüllt ward. (7)
8. Aber ein Götzenbild, das durch Menschenhände gemacht wird, ist verflucht, das Bild und der Künstler: dieser, weil er es gemacht, jenes, weil es ein Gott genannt wird, da es doch ein zerbrechliches Ding ist. Ps. 113, 4; Bar. 6, 3.
9. Denn Gott sind beide gleich verhasst, der Gottlose und sein gottloses Wesen:
10. und das Werk muss mit dem Künstler zugleich gestraft werden.
11. Darum werden auch die Götzen der Heiden nicht verschont bleiben (8), weil sie aus Geschöpfen Gottes zu Gräueln wurden (9), zur Verführung der Seelen der Menschen, zur Falle den Füßen der Toren:
12. denn die Erfindung der Götzen ist der Hurerei Anfang (10) und ihre Einführung das Verderbnis des Lebens.
13. Sie waren nicht von Anbeginn und werden auch nicht ewiglich bleiben.
14. Durch die Eitelkeit (11) der Menschen kamen sie in die Welt, und darum hat sich gefunden, dass kurz ihr Ende sei.
15. Ein über den frühen Tod seines Sohnes tief trauernder Vater ließ sich ein Bildnis des Entrissenen machen und fing nun denjenigen als einen Gott zu verehren an, der unlängst als ein Mensch gestorben war (12): dann stellte er unter seinen Dienern Feste und Opfer an,
16. so dass mit der Zeit die gottlose Sitte überhandnahm, der Irrtum wie ein Gesetz beobachtet wurde, und Tyrannen befahlen, geschnitzte Bilder zu verehren. (13)
17. Wenn man die Menschen persönlich (14) nicht verehren konnte, weil sie zu weit weg waren, brachte man ihre Bildnisse von weitem her, man machte sich ein sichtbares Bildnis von dem König, den man ehren wollte, so dass man den Abwesenden ebenso sorgfältig verehrte wie den Gegenwärtigen.
18. Auch gab der besondere Fleiß des Künstlers diesem Dienst bei den Unwissenden noch Vorschub.
19. Denn um dem zu gefallen, der ihn aufgenommen hatte (15), wandte er alle seine Kunst an, die Ähnlichkeit höher zu treiben. (16)
20. Der Pöbel wurde dann durch die Schönheit des Werkes verführt und hielt nun denjenigen für einen Gott, der kurz vorher nur wie ein Mensch geehrt ward.
21. Daher kam jener Betrug in das Menschenleben, dass die Menschen entweder ihrer Neigung zu Folge oder ihren Königen zu Gefallen Steinen und Holz den unmittelbaren Namen beilegten. (17)
22. Und nicht genug, dass sie in der Erkenntnis Gottes irren, sie nennen sogar so viele und so große Übel Friede, obwohl sie in dem großen Streit der Unwissenheit fortleben. (18)
23. Denn (19) entweder opfern sie ihre Kinder oder bringen sonst heimliche Opfer (20) oder halten Nachtwachen voll Unsinns. (21) 5. Mos. 18, 10. Jer. 7, 6.
24. So bewahren weder die Reinheit des Lebens noch der Ehe (22), sondern einer erwürgt aus Neid (23) den anderen aber betrübt ihn durch Ehebruch:
25. Alles geht bei ihnen vermischt durcheinander: Blut (24), Mord, Diebstahl und Betrug, Verführung und Untreue, Aufruhr und Meineid, Beunruhigung der Guten,
26. Gottes-Vergessenheit (25), Befleckung der Seelen (26), Verwechslung des Geschlechts (27) Unbestand der Ehen, Unordnung, Ehebruch und Unzucht.
27. Denn der schändliche Götzendienst ist aller Übel Ursache, Anfang und Ende.
28. Sie rasen, wenn sie sich ergötzen (28) oder weissagen doch falsch, leben ungerecht und schwören leicht Meineid.
29. Denn da sie auf leblose Götzen vertrauen, hoffen sie, dass es ihnen nicht schade, wenn sie falsch schwören.
30. Darum wird sie für beides gerechte Strafe treffen (29), weil sie übel von Gott dachten, an die Götzen sich hingen und falsch schworen, betrüglich die Gerechtigkeit verachtend. (30)
31. Denn nicht die Macht derer, bei denen man schwört, sondern die Strafe der Sünde trifft immer die Übertretung der Ungerechten. (31)
Anmerkungen:
1. Der heilige Verfasser zeigt weiter die Torheit des Götzendienstes an einem Seefahrer, der bei den großen Gefahren, die seiner warten, nicht an den allmächtigen Gott, sondern an ein gebrechliches Götzenbild sich wendet.
2. das Schiff. Von Vers 2-7 folgen nun einige Zwischenbemerkungen über die Schifffahrt, wie sie durch Gottes Zulassung von den Menschen erfunden worden, damit seine Allmacht offenbar würde, und wie sie von Gott in der Sündflut zum Segen der Menschheit benützt wurde.
3. wie dies in den ersten Zeiten geschah, da die Schifffahrt noch unbehilflich war. Sinn der drei Verse: Das Schiff hat zwar der Mensch erfunden, aber durch Gottes Fügung. Dieser leitet es auf dem Meer, wenn es auch in den Händen ungeschickter Seefahrer sein wollte, um seine Allmacht zu zeigen.
4. eben die Schifffahrt.
5. Siehe 1. Mos. 6, 4.
6. Noe und seine Familie.
7. Im Griech.: wodurch die Gerechtigkeit (der gerechte Noe) erhalten wurde. And. Mehrere heil. Väter finden in dem Holz der Arche Noes ein Vorbild des Kreuzholzes.
8. Sondern zerstört werden. Die Propheten hatten dies vorher verkündet. S. Jer. 10, 15; Isai. 2, 20; Ezech. 30, 13.
9. Die Götzen waren aus Holz, Stein oder Metall verfertigt.
10. Die Götzen wurden gewöhnlich durch Unzucht verehrt, so dass diese, wenn sie auch früher schon bestand, durch den Götzendienst erst recht verbreitet, weil gewissermaßen geheiligt ward. Da der Götzendienst eine geistige Hurerei ist (s. 3. Mos. 17, 7) und der Mensch das immer im Werk vollzieht, was er im Geist geworden, so musste die Unzucht sich mit dem Götzendienst verbinden.
11. Torheit, eitle Ruhmsucht, wie das Folgende zeigt.
12. Der heilige Verfasser gibt hier eine der verschiedenen Ursachen des Götzendienstes, ohne die übrigen auszuschließen.
13. Eine andere Ursache ist der Stolz der Könige, welche befahlen, ihre Bilder göttlich zu verehren. Vergl. Dan. 3, 1-22.
14. unter den Augen.
15. zum Werke bestellt hatte.
16. And.: das Bild zur höchsten Schönheit zu bringen (es zu idealisieren).
17. den göttlichen Namen.
18. Denn der Irrtum beruhigt nur auf eine kurze Dauer den Verstand, und stürzt ihn dann in um so größere Zweifel und Kämpfe.
19. Nun werden die Übel, welche sie Friede, Glück nennen, beschrieben.
20. Im Griech.: hielten Gottesdienst, der nicht ans Licht kommen darf. – Die Einweihungen zum Dienst der Ceres, des Priapus und anderer Götzen geschahen des Nachts in unterirdischen Gängen oder finsteren Wäldern und waren so abscheulich, dass selbst die heidnischen Schriftsteller sie nicht beschreiben wollten. Vergl. Ephes. 5, 12.
21. Im Griech. … hielten wütende Fressereien nach ungewöhnlicher Sitte. – In den Tempeln der Heiden hielt man nächtliche Mahle, nach denen man sich der unsinnigsten Wollust überließ und den Göttern zu ehren die empörendste Unzucht trieb. Mädchen und Frauen mussten sich den Opferpriestern preisgeben, wie wenn die Götter in sie verliebt wären. – Von diesen Gräueln hat uns das Christentum befreit, aber Schande und Weh dem Christen, der zu ihnen freiwillig zurückkehrt!
22. Denn wer Gott verlässt, kommt über kurz oder lang auch von aller Tugend ab und fällt aus einem Abgrund des Bösen in den andern.
23. Im Griech.: durch List.
24. Verwundung.
25. Im Griech. Undank.
26. Vergiftung (unschuldiger) Seelen. And. Selbstbefleckung.
27. unnatürliche Geschlechts-Vermischung. S. Röm. 1, 26.
28. u. B. bei den schwärmerischen Festen, die dem Bacchus zu Ehren gegeben wurden, bei denen sich die Weiber wie Rasende gebärdeten.
29. für die Abgötterei und für den Meineid.
30. Im Griech.: betrüglich die Heiligkeit (des Eides) verachtend.
31. Die Meineidigen werden nicht gestraft wegen der Macht derjenigen, bei denen sie schwören, sondern wegen der Bosheit, die an und für sich in jedem Meineid liegt. Die arab. Übersetzung gibt: Denn nicht die Macht derer, bei denen man schwört, sondern die Sünde der Gottlosen bestimmt immer die Strafe der Verbrecher. –
aus: Allioli, ebd., S. 433 – S. 436
Bildquelle
- Allioli-bibel-3: © https://katholischglauben.online